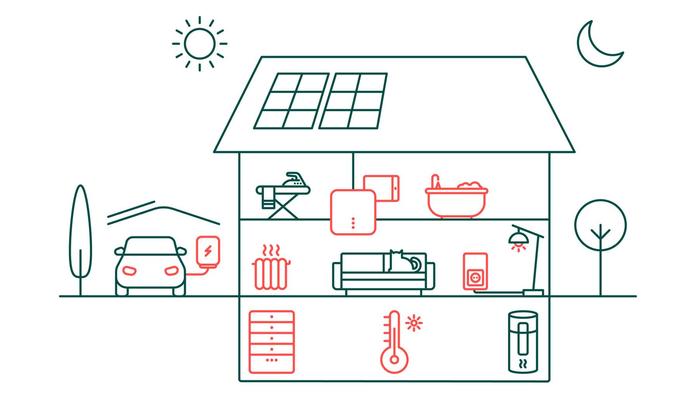Einspeisevergütung 2025
Das im Jahr 2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fördert die Umstellung unserer Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Eine Form der im Gesetz festgeschriebenen Förderungen ist die Einspeisevergütung, die in unterschiedlicher Höhe für Windkraft-, Solar-, Wasserkraft-, Geothermie- und Biomasseanlagen gezahlt wird.
Das bedeutet: Jede aus erneuerbaren Energien erzeugte Kilowattstunde Strom, die ins öffentliche Netz eingespeist wird, wird über 20 Jahre hinweg garantiert vergütet.
Im Folgenden liegt der Fokus jedoch auf der Einspeisevergütung für Solarstrom aus privaten Photovoltaikanlagen.
Was ist die Einspeisevergütung?
Die Einspeisevergütung, gelegentlich auch als Einspeisungsvergütung bezeichnet, ist eine staatlich festgelegte Vergütung, um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, d. h. mit Windkraft-, Solar-, Wasserkraft-, Geothermie- und Biomasseanlagen erzeugten Strom, zu fördern.
Die Einspeisevergütung wurde mit dem EEG eingeführt. Ziel war es, die erneuerbaren Energien, die sich damals noch nicht selbst tragen konnten, über einen garantierten Mindestpreis in den Markt zu integrieren.
Diese Aufgabe wurde erfüllt, weshalb die Vergütungssätze heute deutlich niedriger ausfallen als in der Anfangszeit.
Wie hoch ist die aktuelle Einspeisevergütung für Solarstrom?
Die Höhe der Photovoltaik-Einspeisevergütung hängt ab von:
- Datum der Inbetriebnahme
- Größe der PV-Anlage
- Art der Einspeisung (Überschuss oder Volleinspeisung)
Wichtig: Jede Photovoltaikanlage muss erst im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert sein. Erst dann besteht Anspruch auf die Einspeisevergütung.
1. Einspeisevergütung nach Inbetriebnahmedatum
In den letzten Jahren sank die Einspeisevergütung monatlich, abhängig von der zugebauten Menge an Photovoltaik-Leistung. Mit der EEG-Novelle 2023 wurde die Einspeisevergütung auf 8,6 Cent / kWh (Anlagen bis 10 kWp) bzw. auf 7,5 Cent pro kWh (Anlagen bis 40 kWp) festgelegt und die Degression vorübergehend ausgesetzt. m August 2022 erfolgte eine Anpassung auf 8,2 bzw. 7,1 Cent/kWh.
Seit dem 1. August 2025 – mit wieder einsetzender Degression – beträgt die Einspeisevergütung 7,86 bzw. 6,80 Cent / kWh (bis 31.01.2026). Die Sätze für die Einspeisevergütung gelten damit immer für 6 Monate. Vollständig abgeschafft wurde durch die EGG-Novelle der als „atmender Deckel“ bezeichnete Steuermechanismus, anhand dessen die Höhe der Degression bestimmt wurde.
2. Größe der PV-Anlage
Bei der Höhe der Einspeisevergütung wird nach der Größe der PV-Anlage unterschieden, je nachdem, ob es sich um eine PV-Anlage bis 10, bis 40 oder 100 kWp handelt.
Umso größer die Anlage ist, umso geringer fällt die Förderung aus. Seit August 2025 werden zum Beispiel folgende Beiträge gezahlt:
| Installierte Leistung (kW) bis | Einspeisevergütung in Cent / kWh |
|---|---|
| bis 10 kWp | 7,86 |
| bis 40 kWp | 6,80 |
| bis 100 kWp | 5,56 |
3. Überschusseinspeisung vs. Volleinspeisung
Das neue EEG unterscheidet zwischen Überschusseinspeisung (auch Teileinspeisung) und Volleinspeisung.
- Überschusseinspeisung (Teileinspeisung): Standard bei privaten Haushalten, da Eigenverbrauch finanziell attraktiver ist
- Volleinspeisung: interessant bei großen Dachflächen
- Volleinspeiser erhalten zur Einspeisevergütung einen Zuschlag von 4,61 bzw. 3,65 Cent pro kWh.
- Möglichkeit: Kombination aus Überschuss- und Volleinspeisung (z. B. zwei Anlagen)
Aufgepasst: Das seit 25. Februar 2025 geltende Solarspitzengesetz verpflichtet neue Anlagen etwa zur Installation eines Smart Meters und Steuerbox. Wer nicht steuerbar ist, muss die Einspeisung auf 60 % der Anlagennennleistung begrenzen.

Wer kann die Einspeisevergütung erhalten?
Grundsätzlich gilt: Jeder, der Strom aus erneuerbaren Energien ins öffentliche Netz einspeist, kann die Einspeisevergütung erhalten. Dafür sind allerdings einige Voraussetzungen nötig:
1. Organisatorische Voraussetzungen
- Anmeldung beim zuständigen Netzbetreiber
- Registrierung im Markstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Ohne diese Schritte gibt es keine Vergütung.
2. Technische Voraussetzungen
- Netzanschluss muss beim Netzbetreiber beantragt werden (In der Regel übernimmt der Fachbetrieb die Antragstellung)
- Netzbetreiber ist zur Herstellung verpflichtet (Umsetzung kann dauern)
- EEG 2023: Vereinfachung des Netzanschlusses beschlossen
3. Messtechnische Voraussetzungen
- Zwei-Wege-Zähler erforderlich (misst sowohl den bezogenen als auch den eingespeisten Strom)
- Diese Messung ist Voraussetzung für die Zahlung der Einspeisevergütung
- Zähler wird vom Netzbetreiber gestellt (gegen geringe Mietgebühr; Kauf lohnt sich in der Regel nicht)

Entwicklung der Einspeisevergütung für die Photovoltaik
Einführung und Ziel
Das Ziel der Einspeisevergütung bei ihrer Einführung war es, die damals noch nicht marktfähigen Techniken zur Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien zu fördern.
- Über einen garantierten Mindestpreis wurde Planungssicherheit geschaffen.
- Dadurch wurden Investitionen in Windkraft, Solarthermie, Photovoltaik u. a. attraktiv.
Degression von Beginn an
Die Einspeisevergütung war von Anfang an degressiv angelegt. Sie sollte also im Zeitverlauf sinken.
- Start: 99 Pfennig/kWh (ca. 50 Cent/kWh)
- Ab 2002: jährliche Senkung um 5 % für neue Anlagen
- Ausbauziel zunächst auf 350 Megawatt begrenzt
Ausbauziele und Solardeckel
Die ursprünglich gesetzten Grenzen wurden mehrfach nach oben angepasst.
- Lange Zeit galt: bei 52 GW PV-Leistung sollte die Förderung enden („Solardeckel“).
- Bei Erreichen wäre die Förderung beendet worden
- Juli 2020: Abschaffung des „Solardeckels“
Anpassungen der Degressionsrate
Um eine Überförderung zu vermeiden, wurde die Degression flexibel gestaltet.
- Zunächst jährliche, dann quartalsweise und schließlich monatliche Anpassung
- Grundlage war lange Zeit das aktuelle Ausbauvolumen:
- viel Zubau = stärkere Degression („atmender Deckel“).
- Mit EEG-Novelle 2023 wurde dieser Mechanismus abgeschafft
- Aktuell: halbjährliche Anpassung
Aktuelle Situation (2025)
Heute ist Photovoltaik weitgehend etabliert, die Vergütung jedoch niedrig.
- Aktuelle Einspeiseverütung: 7,86 Cent pro kWh (bis 10 kWp)
- Einspeisevergütung bleibt ein Beitrag zur Refinanzierung, aber kein Haupttreiber mehr
- Eigenverbrauch ökonomisch sinnvoller:
- Strompreis ca. 33 ct/kWh
- Gestehungskosten PV-Strom ca. 6,3 ct/kWh
- Eigenverbrauch spart mehr Geld als Einspeisung einbringt
- Der sogenannte Marktwert Solar erheblich an Bedeutung
- Der Jahresmarktwert für Solarstrom gibt an, welchen durchschnittlichen Erlös eingespeister Strom im Jahr erzielen kann.
- Bei ausgeförderten Anlagen oder im Fall der Direktvermarktung wird dieser Wert zur entscheidenden Kenngröße.
Einspeisevergütung als Einnahme
Beitrag zur Finanzierung
Die Einnahmen aus der Einspeisevergütung tragen zur Finanzierung einer Photovoltaikanlage bei. Auch wenn sie mittlerweile eher gering sind, müssen sie unter Umständen steuerlich berücksichtigt werden.
- Steuerliche Relevanz: abhängig von Lohnsteuergesetz 2022 und Nullsteuersatz
- Betrifft nur einen kleinen Teil privater Betreiber
Umsatzsteuerliche Behandlung
Nicht alle Betreiber profitieren automatisch von der Steuerfreiheit.
- Ohne Kleinunternehmer-Regelung: Umsatzsteuer auf Einspeisevergütung
- Eigenverbrauch zählt als "Entnahme von Betriebsvermögen/Betriebsmitteln für private Zwecke"
- Umsatzsteuergrenzen beachten
Berücksichtigung bei der Ertragssteuer
Einnahmen aus der Einspeisevergütung sind bei der Ertragssteuer (bzw. Einkommenssteuer für Privatpersonen) relevant.
- Unter bestimmten Voraussetzungen möglich: formloser schriftlicher Antrag zur Befreiung
Selbstständige und PV-Einnahmen
Für Selbstständige gelten besondere Regeln.
- Einnahmen aus der PV-Anlage werden steuerlich der Selbstständigkeit zugerechnet
- Überschreitung der Umsatzsteuergrenzen bei Kleinunternehmern möglich
Was passiert nach dem Auslaufen der Einspeisevergütung?
Die Einspeisevergütung wird für 20 Jahre gezahlt. Nach dem Auslaufen der EEG-Förderung (Marktprämien, Einspeisevergütungen oder Mieterstromzuschläge) bleibt der Anspruch auf Netzanbindung – und die damit verbundene Abnahmepflicht des Stroms nach § 8 EEG – erhalten.
Im Jahr 2020 wurde eine weiterführende Lösung für sogenannten „Post-EEG-Anlagen“ ins Gesetz aufgenommen. Laut EEG Novelle 2021 erhalten die Betreiber, vorerst bis 2027, für den Strom ausgeförderter Anlagen eine Vergütung in Höhe des Marktwertes (= durchschnittlicher Börsenstrompreis) abzüglich einer Vergütungspauschale.
Die auf diesem Wege erzielbaren Vergütungssätze pro Kilowattstunde liegen zwischen 3 und 4 Cent. Eine Volleinspeisung lohnt sich also noch weniger, der selbst erzeugte Strom sollte weitestgehend in den Eigenverbrauch fließen.